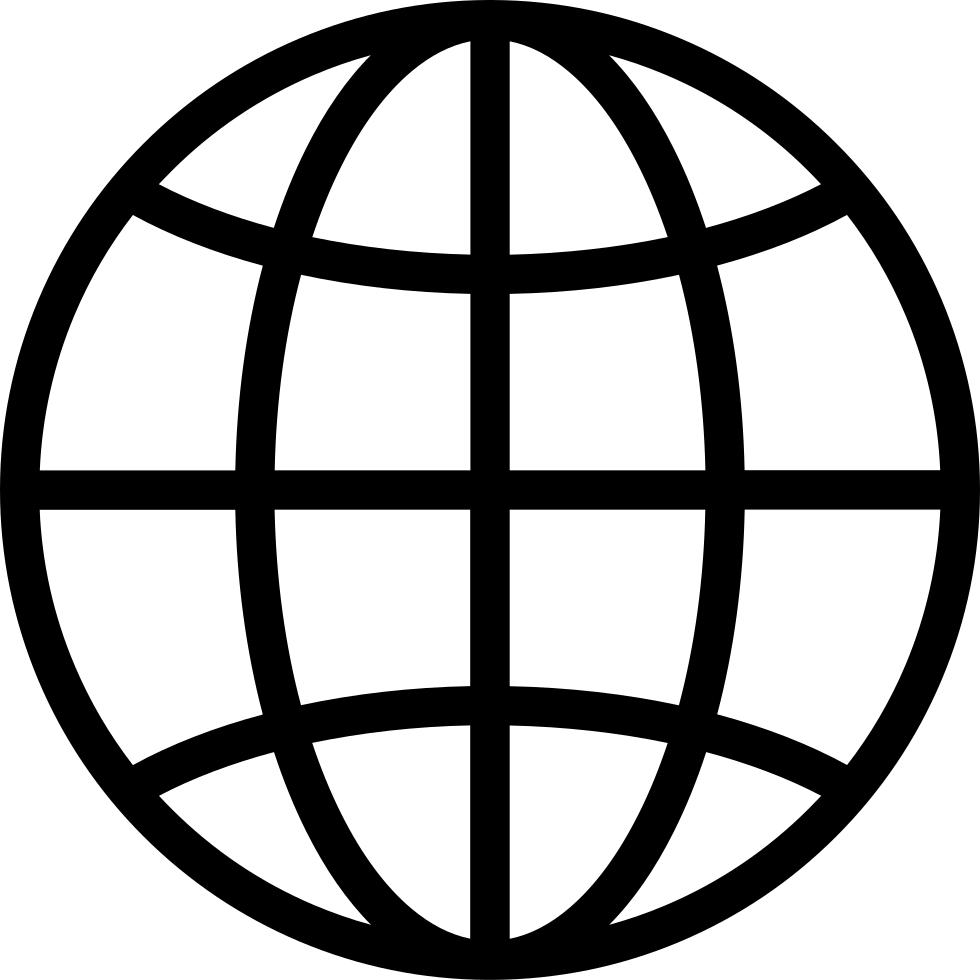با برنامه Player FM !
Hochwasserschutz - Polder, Deiche, mobile Wände
Manage episode 418475206 series 2459771
Wenn der Flusspegel steigt, können Polder die Wassermassen aufnehmen. Doch es gibt zu wenige - stattdessen zwängen Deiche die Flüsse ein. Mit mobilen Wänden versuchen Städte sich vor Hochwasser zu schützen. Aber auch sie können Überschwemmungs- und Versickerungsflächen vorsehen, damit die Häuser trocken bleiben. Von Renate Ell
Credits
Autorin dieser Folge: Renate Ell
Regie: Kirsten Böttcher
Es sprach: Rahel Comtesse
Technik: Wolfgang Lösch
Redaktion: Hellmuth Nordwig
Im Interview:
Dr. Albert Göttle, früherer Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt und des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft
Prof. Dr.-Ing. Arnd Hartlieb, Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Technische Universität München
Prof. Dr.-Ing. i.R. Wolfgang Günthert, Forschungszentrum RISK, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg
Reinhard Riku Vogt, HochwasserKompetenz-Centrum e.V.
Linktipps:
IQ – Wissenschaft und Forschung Vor der Sturzflut
Bayerisches Landesamt für Umwelt: Hochwasserschäden vorbeugen
HIER
TU München, Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft
HIER
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V
HIER
HochwasserKompetenzCentrum e.V.: Hochwasser-Pass für Immobilien
HIER
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.
RadioWissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | RadioWissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ERZÄHLERIN
Das Wasser steigt. Überwindet die Ufer, kriecht die Straße entlang, erreicht das Grundstück. Jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu handeln – schon dringen die ersten schlammigen Rinnsale durch die Kellerfenster ein, dann immer mehr. Und die Pegel steigen weiter!
ATMO NOCHMAL HOCH
Musik 2: Affected cities – 41 Sek
ERZÄHLERIN
Das könnte durch den Klimawandel in Zukunft öfter Realität werden, immer mehr Menschen treffen: Ein Tiefdruckgebiet bleibt sozusagen hängen über einer Region, und lässt mit wochenlangem Regen die Flüsse in einem großen Gebiet über die Ufer treten. Oder, ebenfalls in den nächsten Jahrzehnten häufiger zu befürchten: Extremwetterlagen mit so starkem Regen, dass Orte innnerhalb kurzer Zeit überschwemmt werden. Sturzfluten können Straßen in reißende Flüsse verwandeln. Aber zumindest wenn es bei Sachschäden bleibt, zeigt die Erfahrung:
(1. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Der Eindruck von einem Hochwasser verbleibt nicht allzu lange, nach wenigen Jahren sind die Folgen mehr oder weniger beseitigt, und die Menschen haben es wieder aus dem Hinterkopf bekommen.
ERZÄHLERIN
Weiß Albert Göttle – Jahrzehnte lang in Bayern mit Hochwasser befasst, an der Technischen Universität München, im Landesamt für Wasserwirtschaft und später im Landesamt für Umwelt. Und deshalb gibt es einen idealen Zeitpunkt, den Hochwasserschutz zu verbessern, das zeigte sich nach dem Pfingst¬hochwasser 1999 im Allgäu.
(2. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Diese damalige Situation war so brisant, man hat Krankenhäuser evakuieren müssen, man hat Gebäude, Industrieanlagen, Altersheime hat man räumen müssen, ich war in diesem Krisenstab und habe das alles hautnah erlebt, und anschließend war der Eindruck groß genug, dass es auch eine hohe Bereitschaft in allen Ebenen gegeben hat, und die Phasen, die wir anschließend erlebt haben, in anderen Standorten, die sind wesentlich schwieriger gewesen.
ERZÄHLERIN
Deshalb gelang es nur im Illertal, innerhalb weniger Jahre einen Polder zu bauen. Also eine große Ausweichfläche für Hochwasser in einer Flussaue. Das Wasser kann in die Breite gehen, der Pegel sinkt.
(3. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Ein Problem bei den Flutpoldern: Man hilft nicht dem, der den Flutpolder auf seinem Gebiet bauen lässt, man hilft dem Unterlieger.
ERZÄHLERIN
Dafür müssen Landwirte ihre Flächen zur Verfügung stellen; nach einer Überschwemmung werden sie natürlich für eine verlorene Ernte entschädigt. Außerdem braucht man einige technische Einrichtungen, um das Wasser im richtigen Moment in den Polder zu leiten. Die Solidarität der Menschen im Illertal wurde allerdings schnell belohnt.
(4. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
2005 wo man es wirklich brauchen konnte, wurde die Stadt Kempten durch die Nutzung dieses Flutpolders, das Abschöpfen der Hochwasserwelle, dann geschont.
Musik 3: Black Ostsee (c) – 48 Sek
ERZÄHLERIN
Der Polder an der Iller war einer von vielen, die nach dem Hochwasser 1999 ins bayerischen „Aktionsprogramm 2020“ und später „2020 plus“ aufgenommen wurden , die meisten an der Donau. Dort dauerte es 20 Jahre, bis der erste Polder fertig war: bei Riedensheim, rund 30 Flusskilometer oberhalb von Ingolstadt. Alle anderen sind entweder im Bau oder sogar noch in der Planung. Vielerorts wehren sich Bürgerinitiativen gegen die Polder.
Da heißt es dann auch manchmal: Warum hier so viel Geld ausgeben, warum unsere Wiesen und Äcker mit schlammigem Wasser überfluten lassen, „das bringt nur ein paar Zentimeter in Passau“. Aber:
(5. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Die paar Zentimeter können entscheidend sein.
ERZÄHLERIN
Sagt Professor Arnd Hartlieb von der Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Universität München.
(6. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Weil in den unterliegenden Städten wird natürlich dann der Hochwasserschutz auch so ausgelegt, dass er zusammenspielt mit den Flutpoldern.
ERZÄHLERIN
Etwa die Höhe von Deichen und Mauern am Ufer. Diesem geplanten Zusammenspiel liegen penible Berechnungen zugrunde, und natürlich Hochwasser-Daten über viele Jahrzehnte, teils sogar über hunderte Jahre. Diese Daten liefern die so genannte Bemessungsgrundlage: in Bayern wird der Schutz auf ein hundertjährliches Hochwasser ausgelegt.
(7. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Das heißt, es tritt in jedem Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 100 auf. Also: Sie haben in jedem Jahr die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass es wieder auftritt. Selbst wenn jetzt ein Riesenereignis war, heißt es nicht jetzt haben wir die nächsten Jahrzehnte Ruhe; sondern das kann im nächsten Jahr wieder passieren.
Musik 4: Black Ostsee – siehe oben – 25 Sek
ERZÄHLERIN
Die Versuchsanstalt der TU München, in der Arnd Hartlieb arbeitet, liegt idyllisch in der Nähe des Walchensees. Dort kann der Forscher mit Experimenten herausfinden, wie ein Polder oder ein Deich gestaltet sein muss, um seine Aufgabe optimal zu erfüllen. Computermodelle helfen ihm dabei. Aber in vielen Fällen genügt das nicht.
(8. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Dann bauen wir die Landschaft nach, teilweise vereinfacht, teilweise in Ausschnitten im Freigelände, teilweise wirklich im Eins-zu-Eins-Maßstab, weil es auch durchaus Probleme gibt, die man eben nicht verkleinern kann, teilweise eben auch verkleinert, aber so, dass es nicht zu klein wird, dass wir diese Übertragung immer noch gegeben haben von dem Modellergebnissen dann auf die Realität.
ERZÄHLERIN
Auf diese Weise zeigt sich nicht nur, welche Fläche ein Polder haben muss, um die Hochwasserwelle flussabwärts um ein bestimmtes Maß zu senken. Sondern auch, wie das so genannte Einlassbauwerk gebaut und gesteuert werden muss. Das ist eine Art Tor in dem Deich, der sich zwischen Fluss und Polderfläche erstreckt.
(9. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Das ist häufig auch eine Möglichkeit, um Kosten einzusparen, wir können ja da auch zum Beispiel dann mal eine Planung abspecken, weil man dann in den Modellversuchen merkt: So groß muss es gar nicht werden oder so kompliziert, weil es auch anders funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, das Einfache, dann hat man den Nachweis: Wir brauchen die teurere, komplexere Lösung, damit es funktioniert.
ERZÄHLERIN
Auch der richtige Zeitpunkt, das Tor zu öffnen, den Polder zu fluten, ist Teil der Modelle. Neben dem Wasserstand im Fluss kann dabei die Wettervorhersagen eine Rolle spielen. Keinesfalls darf ein Polder zu früh geflutet werden – weil seine Wirkung verpufft, wenn die Spitze der Hochwasserwelle erst danach den Fluss entlang rollt. Und weil man auch nicht unnötig die Wiesen oder Äcker im Polder überfluten will.
(10. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Im einen Fall kann es sinnvoll sein, schon zu fluten, weil man jetzt weiß: Bei dem Wasserstand und im Abfluss habe ich annähernd schon die Spitze erreicht, und ich muss schon entlasten. Aber wenn ich weiß, es kommt noch mehr, dann würde ich das Bauwerk wahrscheinlich eher erst noch weniger aufmachen.
Musik 5: Conspiracy – 1:14 Min
ERZÄHLERIN
Aus der Wasserwirtschaft kam vor einigen Jahren die Idee einer simplen und preiswerten Alternative zu einem aufwendigen Stahl-Tor zwischen Deich und Polder, die Arnd Hartlieb auch auf die Probe gestellt hat. Auf einer längeren Strecke wird ein Betonsockel gebaut, der etwas niedriger ist als der Deich. Darauf liegt ein Aufsatz aus Sand und Kies, der auf der gleichen Höhe endet wie der Deich. Damit hat der Deich eine geplante Schwachstelle – Fachleute nennen sie „erodierbare Überlaufstrecke“. Ein Film der Modell-Experimente zeigt, wie das steigende Wasser erst langsam in diesen Aufsatz einsickert – und dann plötzlich Wasser, Sand und Kies in einem Schwung den Betonsockel hinab in den Polder rauschen. Dadurch sinkt der Wasserstand im Fluss sehr schnell. Eine solche Konstruktion wird an der Donau bei Straubing gebaut. Entscheidend ist die passende Kombination von Sand und Kies, die Arndt Hartlieb in Experimenten ermittelt hat: Sie soll halten, solange das Wasser noch niedrig steht.
(11. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Ich kann dann eigentlich sehr gut vorhersagen, wann dieser große Abfluss dann auf 90 Meter Breite zum Beispiel in diesen Flutpolder fließt. Wenn ich das mit einem gesteuerten Einlass-Bauwerk haben wollte, dann müsste das sehr, sehr groß sein und sehr, sehr breit und sehr, sehr teuer.
ERZÄHLERIN
Polder werden in Bayern vor allem an der Donau gebaut, einer am Main und demnächst auch einer am Inn. Dort, das haben Experimente mit einem nachgebauten Flussbett gezeigt, braucht man ein vergleichsweise kleines Überflutungsgebiet, weil man im Fluss selbst Platz schaffen kann für zusätzliches Wasser. Denn vor den Stauwehren der Wasserkraftwerke sammelt sich im Lauf der Zeit an der Sohle des Flussbetts Sand und Geröll aus den Alpen an. Bei Hochwasser werden die Stauwehre geöffnet.
(12. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Dann hat man plötzlich viel höhere Geschwindigkeiten in Stauräumen, und sehr, sehr viel Sohlmaterial kommt in Bewegung, wird weiter transportiert, und die Sohle sinkt stark ab. Und damit entsteht eben dann Volumen im Hochwasserfall, da bleibt mehr Wasser im Inn, als wenn ich jetzt von dieser Sohle im normalen Betriebszustand ausgehen würde.
ATMOS Wiese + Fluss
ERZÄHLERIN
An kleineren Flüssen braucht man keine aufwändigen Polder, um das Hochwasser erstmal in die Breite gehen zu lassen und damit die Welle flussabwärts zu kappen. Einfacher ist es, den Fluss bei Hochwasser dort aufzustauen, wo sich das Wasser in Auwiesen verteilen kann. Ein solches Hochwasser-Rückhaltebecken gibt es etwa an der Paar südlich von Augsburg. Dazu wird ein unauffälliges Stauwehr in den Fluss gebaut.
(13. Zusp.) Arnd Hartlieb
Bis zu einem gewissen Hochwasserabfluss fließt einfach das Gewässer weiterhin fröhlich durch die Landschaft, und erst, wenn eben ein bestimmter Abfluss erreicht wird, den die Unterlieger nicht mehr verkraften können, beginnt dann automatisch eine Drosselung, und da entsteht dann eben ein sehr großflächiger See, der allerdings relativ geringe Wassertiefen hat.
Musik 6: Aortic... aus: The Knick - Original Series Soundtrack – 25 Sek
ERZÄHLERIN
Immer wieder wird auch die Renaturierung von Flussauen gefordert, um dem Hochwasser Raum zu verschaffen. Arnd Hartlieb hat die Wirkung solcher Maßnahmen an der Donau untersucht, mithilfe rund 200 Jahre alter Landkarten und einem Computermodell. So konnte er das gleiche Hochwasser einmal durch die historische Landschaft schicken und einmal durch die heutige.
(14. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Da kann man dann halt wirklich nachweisen, dass gerade bei diesen großen Hochwasserabflüssen sich gar nicht viel verändert, was Wasserstände und auch Zeitpunkte der Hochwasser Spitze sozusagen angeht, dass aber bei kleineren Hochwasserabflüssen diese Renaturierung schon einen deutlichen Effekt hat und eine Verbesserung bringt.
ERZÄHLERIN
Ist ein Fluss renaturiert, werden Polder also nur bei großen Hochwassern gebraucht – und an vielen Stellen ist auch ein Deich nötig, der Siedlungen und Infrastruktur schützt. In Stadtzentren stehen oft Mauern am Flussufer. Aber deren Höhe sind gestalterische Grenzen gesetzt. Und es gibt Extremsituationen, für die kein Deich, keine Mauer hoch genug sein kann. Etwa wenn im Winter Dauerregen und Schneeschmelze auf einen bereits wassergesättigten Boden treffen. Dann kommt die große Stunde des mobilen Hochwasserschutzes. Der Klassiker: Sandsäcke.
(15. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Sandsäcke sind für mich Steinzeit.
ERZÄHLERIN
Sagt Riku Reinhard Vogt vom Hochwasser-Kompetenz-Centrum, einem gemeinnützigen Verein; bis 2014 war er für den Hochwasser-Schutz der Stadt Köln verantwortlich.
(16. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Man brauche so viele Leute dafür. Das Ganze ist meistens undicht. Die sind nachher kontaminiert, sie sind nicht wiederverwendbar.
ERZÄHLERIN
Sandsäcke eignen sich, um schnell einen Deich zu flicken, aus dem das Hochwasser Stücke herausgerissen hat. Aber um etwa eine Siedlung zu schützen, auf die das Wasser zuströmt, gibt es bessere Systeme. Zum Beispiel riesige Schläuche. Die Feuerwehr befüllt sie am Einsatzort mit Wasser; sie hat Pumpen, mit denen das sehr schnell geht.
(17. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Und hat dann den Hochwasserschutz meistens bis zu einer Höhe von einem Meter, aber es gibt auch Systeme, wo mehrere Schläuche übereinander sind die also auch ohne weiteres drei Meter Höhe schaffen.
ERZÄHLERIN
Viel simpler und deshalb für Privathaushalte geeignet sind L-förmige Elemente, die man in einer Reihe nebeneinander aufstellen kann. Der kurze Schenkel am Boden zeigt in die Richtung, aus der das Hochwasser kommt und wird dann vom steigenden Wasser nach unten gedrückt, so steht die Wand stabil. Schnell aufgebaut ist auch ein Baukastensystem aus Europaletten oder anderen Platten, die mit Stützen aufrecht gestellt werden, plus einer kräftigen Folie.
(18. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Die Folie wird dann in den Rasen kurz mit einem Spaten hineingebracht, sodass da die Verbindung da ist, und diese Platten Systeme haben wir zum Beispiel 600 Meter in viereinhalb Stunden aufgebaut. Für 600 Meter braucht man 60.000 Sandsäcke, die hat man nicht in vier Stunden gefüllt, und die sind auch nicht so wirksam.
ERZÄHLERIN
Beliebt in hochwassergefährdeten Gemeinden sind so genannte Dammbalken-Wände, die man sich wie hochkant gestelltes Parkett vorstellen kann. Wobei die einzelnen Balken aus Aluminium bestehen, mit einer Gummidichtung. Damit lassen sich schnell enge Durchlässe schließen oder Mauern erhöhen – vorausgesetzt, man hat vorher entsprechende Halterungen für die Stützen und Wandanschlüsse installiert. Das erfordert also Planung und verursacht Kosten in trockenen Zeiten.
(19. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Mobiler Hochwasserschutz ist eine Investition, auch wenn sie sich auf Dauer rechnet. Aber keiner weiß natürlich, wann das nächste Hochwasser ist.
Musik 7: Conspiracy – siehe oben – 29 Sek
ERZÄHLERIN
Riku Reinhard Vogt berät Städte und Gemeinden in ganz Deutschland im Auftrag der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Er schaut sich an, wie gut sie auf Hochwasser vorbereitet sind und was sie verbessern können. Wie sieht der Bebauungsplan aus, welche Infrastruktur ist gefährdet? Hat die Gemeinde Alarmpläne und Gefahrenkarten? Wie sieht die Öffentlichkeitsarbeit aus?
(20. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Ich schlage immer wieder vor: Warum macht ihr nicht einfach an Laternenpfählen eine Marke für ein Extremhochwasser, so hoch kann es stehen, dann kann kein Mensch jemals sagen, er hat es nicht gewusst. Und jeder sich darauf vorbereiten.
Musik 8: Black Ostsee – siehe oben – 22 Sek
ERZÄHLERIN
In Bayern fördert das Landesamt für Umwelt diese so genannten Hochwasser-Audits. Und das Hochwasser-Kompetenz-Centrum, bietet etwas ähnliches für Privatleute und Firmen an, den Hochwasser-Pass, der auch als Gutachten für eine Elementarschaden-Versicherung anerkannt wird.
ATMO GEWITTER + STARKREGEN
ERZÄHLERIN
Wer sich aber jetzt zurücklehnt und meint, ich wohne weit weg von einem Fluss oder Bach – mich kann es nicht treffen – liegt falsch:
(21. ZUSP.) WOLFGANG GÜNTHERT
Starkregen ist etwas, was kurzzeitig innerhalb von Stunden passiert, ist eine Überflutung direkt vor Ort, und dann kann es jeden Ort treffen.
ATMO Kanalisation
ERZÄHLERIN
Warnt Professor Wolfgang Günthert vom Forschungszentrum RISK der Universität der Bundeswehr München. Weil immer mehr Flächen versiegelt sind, fließt das Wasser auf Straßen oder Feldwegen in die Orte. (ATMO Unterwasser) Und dort erstmal in den Kanal unter der Straße.
(22. ZUSP.) WOLFGANG GÜNTHERT
Man sagt, der Kanal nimmt üblicherweise ein seltenes Ereignis auf, was so alle drei bis fünf Jahre eintritt. Uns bei einem zehnjährigen, 15-jährigen Ereignis fließt es oben aus dem Kanaldeckel raus.
ERZÄHLERIN
Und von dort womöglich in den nächsten Keller. Starkregen werden durch den Klimawandel häufiger, deshalb versuchen einige Städte inzwischen, das Wasser an der Oberfläche in bestimmte Bahnen zu lenken; etwa auf einer Straße in einen Park, wo es versickern kann. Für solche Konzepte gibt es das griffige Schlagwort „Schwammstadt“.
(23. ZUSP.) WOLFGANG GÜNTHERT
Im Baugesetzbuch gibt es schon Vorgaben für die Bauleitplanung, dass Niederschlagswasser möglichst vor Ort wieder versickert werden soll, das steht da ganz klar drin. Auch im Wassergesetz steht es drin. Niederschlags¬wasser soll möglichst versickert werden.
ERZÄHLERIN
Um Schäden zu vermeiden und um das Grundwasser wieder aufzufüllen, das durch einige sehr trockene Jahre stark abgesunken ist. Aber Wolfgang Günthert sagt auch: Die Gemeinden sind nicht allein dafür zuständig, die Habe ihrer Bürgerinnen und Bürger vor Wasser zu schützen.
(24. ZUSP.) WOLFGANG GÜNTERT
Das erste ist, dass man in den Keller geht und schaut: Habe ich unwieder¬bringliche Dinge im Keller und die sofort aus dem Keller entfernen, nach oben bringen. Das zweite ist, im Keller zu schauen: Habe ich eine Rückstau¬sicherung vom Kanal. Wenn ich Starkregen habe, ist der Kanal ja bis zur Straßenoberkante voll, und wenn die Rückstausicherung bei mir im Haus nicht funktioniert, dann flute ich meine eigenen Keller. Und das ist etwas, da bin ich selbst verantwortlich, das wissen viele nicht. Und das dritte ist, was ich auch jedem rate: eine Elementarschadenversicherung zu haben.
MUSIK 9: BLACK OSTSEE – S.O. – 35 SEK
ERZÄHLERIN
Alle sollten sich also Gedanken darüber machen, wie sie sich vor Wasser schützen können. Aber vieles bleibt doch die Aufgabe von Kommunen oder dem Land – vor allem die Genehmigung großer Bauprojekte an Flüssen. Nur Polder, Deiche oder Mauern können Siedlungen, Industrieanlagen und Infrastruktur vor starkem Hochwasser in Flüssen bewahren. Viele dieser Baumaßnahmen wurden in Bayern nach großen Hochwassern geplant, etwa 1999 oder 2013 – und kamen dann ins Stocken. In den letzten Jahren zum Teil aufgrund steigender Baukosten.
(25. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Und die Bürgerbeteiligung kann sich ein Jahrzehnt oder länger hinziehen,
ERZÄHLERIN
weiß Albert Göttle, der Jahrzehnte lang für Hochwasser-Themen verantwortlich war. In den Debatten geht es etwa um die Befürchtung, dass, wenn ein Polder geöffnet wird, auch die Keller in benachbarten Wohngebieten voll laufen. Und die Grundbesitzer müssen überzeugt und ihre Entschädigung im Überflutungs-Fall geregelt werden. Dafür sind die Wasserwirtschaftsämter zuständig – die aber im Zuge der Entbürokratisierung in Bayern verkleinert oder zusammengelegt wurden. Viele Arbeiten mussten Ingenieurbüros übernehmen. Keine optimale Lösung, findet der Fachmann:
(26. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Die Ingenieurarbeit, die kann man auslagern. Aber zu wissen, was geplant werden muss, die Moderation zum Beispiel mit den Kommunen, wir haben dies und jenes Konzept: So etwas kann ein Ingenieurbüro bedingt machen. Eine Fachbehörde hat einen ganz anderen Zugang zu den Kommunen, weil sie in vieler Hinsicht – Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und so weiter – Partner der Kommune ist. Und diese Planungsleistung, Vorplanungsleistung, die wurde erschwert, indem man gutes Personal nicht erneuern konnte, wenn sie ausgeschieden sind, oder nicht so erneuern konnte, wie man es gebraucht hätte.
ERZÄHLERIN
Behörden sind auch gefragt, wenn es darum geht, gesetzliche Regelungen umzusetzen.
(27. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Durch eine EU-Vorschrift ist es auch Pflicht, dass alle Länder in der EU sogenannte Hochwasserrisiko-Managementpläne machen.
ERZÄHLERIN
In Bayern findet man die Pläne auf den Webseiten des Landesamtes für Umwelt – einschließlich der wichtigen Gefahrenkarten. Die deutlich zeigen, welche Orte zu stark gefährdet sind, um dort ein neues Bau- oder Gewerbegebiet zu errichten. Was heute auch durch das Wasser-Haushaltsgesetz verboten ist. Früher war das anders.
(28. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
In Überschwemmungsgebieten wurden Siedlungen errichtet in den 60er 70er-Jahren, es gab Landratsämter, die waren so geführt von ihrem Landrat, dass man manches durchgewunken hat gegen den fachlichen Rat der Wasserwirtschaft, später kam dann die Wahrheit, und dann war Wehklagen und dann Ruf nach Entschädigung. Die Objekte, die im Hochwassergebiet wissentlich hineingebaut werden, sind weniger geworden, weil die Rechtsnormen, die man heute erfüllen muss und die lokale Entscheidungs-Kompetenz ein Stück verändert ist.
ERZÄHLERIN
Auch der Einspruch eines Wasserwirtschaftsamts hat heute mehr Gewicht. Damit nicht noch mehr Flächen versiegelt, einem Fluss nicht noch mehr Platz genommen wird für Hochwasser. Zum Schaden der Menschen flussabwärts.
MUSIK 10: BLACK OSTSEE – SIEHE OBEN – 41 SEK
ERZÄHLERIN
Hochwasserschutz – das sind große Bauwerke wie Deiche und Polder; kleinere wie ein Stauwehr oder eine Mauer; oder mobile Barrieren. Hochwasserschutz ist aber auch: Nicht zu bauen – im Überschwemmungsgebiet eines Flusses. Flächensparsam zu bauen, um nicht noch mehr Boden zu versiegeln. Hochwasserschutz ist: Forschen und Experimentieren, planen und debattieren, um die optimale Lösung für den jeweiligen Ort zu finden. Und es ist auch: Solidarität mit den Menschen, die im Nachbarort leben, oder weit flussabwärts.
MUSIK 11: TRUTH DEVELOPMENT INC – 46 SEK
Von den sieben Poldern die nach dem Pfingsthochwasser 1999 geplant wurden, sollten sechs an der Donau entstehen – bis heute gibt es dort nur einen. Die Menschen in Regensburg oder Passau können nur hoffen, dass die anderen fertig werden, bevor das nächste Hochwasser kommt. Kempten hingegen hatte die Solidarität der Menschen flussaufwärts im Illertal: Dort wurde innerhalb weniger Jahre ein Polder gebaut – als die Eindrücke vom Pfingsthochwasser 1999 noch frisch waren. Solidarität und schnelles Handeln – das sind also wichtige Erfolgsfaktoren für den Hochwasserschutz.
2478 قسمت
Manage episode 418475206 series 2459771
Wenn der Flusspegel steigt, können Polder die Wassermassen aufnehmen. Doch es gibt zu wenige - stattdessen zwängen Deiche die Flüsse ein. Mit mobilen Wänden versuchen Städte sich vor Hochwasser zu schützen. Aber auch sie können Überschwemmungs- und Versickerungsflächen vorsehen, damit die Häuser trocken bleiben. Von Renate Ell
Credits
Autorin dieser Folge: Renate Ell
Regie: Kirsten Böttcher
Es sprach: Rahel Comtesse
Technik: Wolfgang Lösch
Redaktion: Hellmuth Nordwig
Im Interview:
Dr. Albert Göttle, früherer Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt und des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft
Prof. Dr.-Ing. Arnd Hartlieb, Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Technische Universität München
Prof. Dr.-Ing. i.R. Wolfgang Günthert, Forschungszentrum RISK, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg
Reinhard Riku Vogt, HochwasserKompetenz-Centrum e.V.
Linktipps:
IQ – Wissenschaft und Forschung Vor der Sturzflut
Bayerisches Landesamt für Umwelt: Hochwasserschäden vorbeugen
HIER
TU München, Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft
HIER
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V
HIER
HochwasserKompetenzCentrum e.V.: Hochwasser-Pass für Immobilien
HIER
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.
RadioWissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | RadioWissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ERZÄHLERIN
Das Wasser steigt. Überwindet die Ufer, kriecht die Straße entlang, erreicht das Grundstück. Jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu handeln – schon dringen die ersten schlammigen Rinnsale durch die Kellerfenster ein, dann immer mehr. Und die Pegel steigen weiter!
ATMO NOCHMAL HOCH
Musik 2: Affected cities – 41 Sek
ERZÄHLERIN
Das könnte durch den Klimawandel in Zukunft öfter Realität werden, immer mehr Menschen treffen: Ein Tiefdruckgebiet bleibt sozusagen hängen über einer Region, und lässt mit wochenlangem Regen die Flüsse in einem großen Gebiet über die Ufer treten. Oder, ebenfalls in den nächsten Jahrzehnten häufiger zu befürchten: Extremwetterlagen mit so starkem Regen, dass Orte innnerhalb kurzer Zeit überschwemmt werden. Sturzfluten können Straßen in reißende Flüsse verwandeln. Aber zumindest wenn es bei Sachschäden bleibt, zeigt die Erfahrung:
(1. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Der Eindruck von einem Hochwasser verbleibt nicht allzu lange, nach wenigen Jahren sind die Folgen mehr oder weniger beseitigt, und die Menschen haben es wieder aus dem Hinterkopf bekommen.
ERZÄHLERIN
Weiß Albert Göttle – Jahrzehnte lang in Bayern mit Hochwasser befasst, an der Technischen Universität München, im Landesamt für Wasserwirtschaft und später im Landesamt für Umwelt. Und deshalb gibt es einen idealen Zeitpunkt, den Hochwasserschutz zu verbessern, das zeigte sich nach dem Pfingst¬hochwasser 1999 im Allgäu.
(2. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Diese damalige Situation war so brisant, man hat Krankenhäuser evakuieren müssen, man hat Gebäude, Industrieanlagen, Altersheime hat man räumen müssen, ich war in diesem Krisenstab und habe das alles hautnah erlebt, und anschließend war der Eindruck groß genug, dass es auch eine hohe Bereitschaft in allen Ebenen gegeben hat, und die Phasen, die wir anschließend erlebt haben, in anderen Standorten, die sind wesentlich schwieriger gewesen.
ERZÄHLERIN
Deshalb gelang es nur im Illertal, innerhalb weniger Jahre einen Polder zu bauen. Also eine große Ausweichfläche für Hochwasser in einer Flussaue. Das Wasser kann in die Breite gehen, der Pegel sinkt.
(3. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Ein Problem bei den Flutpoldern: Man hilft nicht dem, der den Flutpolder auf seinem Gebiet bauen lässt, man hilft dem Unterlieger.
ERZÄHLERIN
Dafür müssen Landwirte ihre Flächen zur Verfügung stellen; nach einer Überschwemmung werden sie natürlich für eine verlorene Ernte entschädigt. Außerdem braucht man einige technische Einrichtungen, um das Wasser im richtigen Moment in den Polder zu leiten. Die Solidarität der Menschen im Illertal wurde allerdings schnell belohnt.
(4. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
2005 wo man es wirklich brauchen konnte, wurde die Stadt Kempten durch die Nutzung dieses Flutpolders, das Abschöpfen der Hochwasserwelle, dann geschont.
Musik 3: Black Ostsee (c) – 48 Sek
ERZÄHLERIN
Der Polder an der Iller war einer von vielen, die nach dem Hochwasser 1999 ins bayerischen „Aktionsprogramm 2020“ und später „2020 plus“ aufgenommen wurden , die meisten an der Donau. Dort dauerte es 20 Jahre, bis der erste Polder fertig war: bei Riedensheim, rund 30 Flusskilometer oberhalb von Ingolstadt. Alle anderen sind entweder im Bau oder sogar noch in der Planung. Vielerorts wehren sich Bürgerinitiativen gegen die Polder.
Da heißt es dann auch manchmal: Warum hier so viel Geld ausgeben, warum unsere Wiesen und Äcker mit schlammigem Wasser überfluten lassen, „das bringt nur ein paar Zentimeter in Passau“. Aber:
(5. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Die paar Zentimeter können entscheidend sein.
ERZÄHLERIN
Sagt Professor Arnd Hartlieb von der Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Universität München.
(6. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Weil in den unterliegenden Städten wird natürlich dann der Hochwasserschutz auch so ausgelegt, dass er zusammenspielt mit den Flutpoldern.
ERZÄHLERIN
Etwa die Höhe von Deichen und Mauern am Ufer. Diesem geplanten Zusammenspiel liegen penible Berechnungen zugrunde, und natürlich Hochwasser-Daten über viele Jahrzehnte, teils sogar über hunderte Jahre. Diese Daten liefern die so genannte Bemessungsgrundlage: in Bayern wird der Schutz auf ein hundertjährliches Hochwasser ausgelegt.
(7. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Das heißt, es tritt in jedem Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 100 auf. Also: Sie haben in jedem Jahr die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass es wieder auftritt. Selbst wenn jetzt ein Riesenereignis war, heißt es nicht jetzt haben wir die nächsten Jahrzehnte Ruhe; sondern das kann im nächsten Jahr wieder passieren.
Musik 4: Black Ostsee – siehe oben – 25 Sek
ERZÄHLERIN
Die Versuchsanstalt der TU München, in der Arnd Hartlieb arbeitet, liegt idyllisch in der Nähe des Walchensees. Dort kann der Forscher mit Experimenten herausfinden, wie ein Polder oder ein Deich gestaltet sein muss, um seine Aufgabe optimal zu erfüllen. Computermodelle helfen ihm dabei. Aber in vielen Fällen genügt das nicht.
(8. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Dann bauen wir die Landschaft nach, teilweise vereinfacht, teilweise in Ausschnitten im Freigelände, teilweise wirklich im Eins-zu-Eins-Maßstab, weil es auch durchaus Probleme gibt, die man eben nicht verkleinern kann, teilweise eben auch verkleinert, aber so, dass es nicht zu klein wird, dass wir diese Übertragung immer noch gegeben haben von dem Modellergebnissen dann auf die Realität.
ERZÄHLERIN
Auf diese Weise zeigt sich nicht nur, welche Fläche ein Polder haben muss, um die Hochwasserwelle flussabwärts um ein bestimmtes Maß zu senken. Sondern auch, wie das so genannte Einlassbauwerk gebaut und gesteuert werden muss. Das ist eine Art Tor in dem Deich, der sich zwischen Fluss und Polderfläche erstreckt.
(9. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Das ist häufig auch eine Möglichkeit, um Kosten einzusparen, wir können ja da auch zum Beispiel dann mal eine Planung abspecken, weil man dann in den Modellversuchen merkt: So groß muss es gar nicht werden oder so kompliziert, weil es auch anders funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, das Einfache, dann hat man den Nachweis: Wir brauchen die teurere, komplexere Lösung, damit es funktioniert.
ERZÄHLERIN
Auch der richtige Zeitpunkt, das Tor zu öffnen, den Polder zu fluten, ist Teil der Modelle. Neben dem Wasserstand im Fluss kann dabei die Wettervorhersagen eine Rolle spielen. Keinesfalls darf ein Polder zu früh geflutet werden – weil seine Wirkung verpufft, wenn die Spitze der Hochwasserwelle erst danach den Fluss entlang rollt. Und weil man auch nicht unnötig die Wiesen oder Äcker im Polder überfluten will.
(10. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Im einen Fall kann es sinnvoll sein, schon zu fluten, weil man jetzt weiß: Bei dem Wasserstand und im Abfluss habe ich annähernd schon die Spitze erreicht, und ich muss schon entlasten. Aber wenn ich weiß, es kommt noch mehr, dann würde ich das Bauwerk wahrscheinlich eher erst noch weniger aufmachen.
Musik 5: Conspiracy – 1:14 Min
ERZÄHLERIN
Aus der Wasserwirtschaft kam vor einigen Jahren die Idee einer simplen und preiswerten Alternative zu einem aufwendigen Stahl-Tor zwischen Deich und Polder, die Arnd Hartlieb auch auf die Probe gestellt hat. Auf einer längeren Strecke wird ein Betonsockel gebaut, der etwas niedriger ist als der Deich. Darauf liegt ein Aufsatz aus Sand und Kies, der auf der gleichen Höhe endet wie der Deich. Damit hat der Deich eine geplante Schwachstelle – Fachleute nennen sie „erodierbare Überlaufstrecke“. Ein Film der Modell-Experimente zeigt, wie das steigende Wasser erst langsam in diesen Aufsatz einsickert – und dann plötzlich Wasser, Sand und Kies in einem Schwung den Betonsockel hinab in den Polder rauschen. Dadurch sinkt der Wasserstand im Fluss sehr schnell. Eine solche Konstruktion wird an der Donau bei Straubing gebaut. Entscheidend ist die passende Kombination von Sand und Kies, die Arndt Hartlieb in Experimenten ermittelt hat: Sie soll halten, solange das Wasser noch niedrig steht.
(11. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Ich kann dann eigentlich sehr gut vorhersagen, wann dieser große Abfluss dann auf 90 Meter Breite zum Beispiel in diesen Flutpolder fließt. Wenn ich das mit einem gesteuerten Einlass-Bauwerk haben wollte, dann müsste das sehr, sehr groß sein und sehr, sehr breit und sehr, sehr teuer.
ERZÄHLERIN
Polder werden in Bayern vor allem an der Donau gebaut, einer am Main und demnächst auch einer am Inn. Dort, das haben Experimente mit einem nachgebauten Flussbett gezeigt, braucht man ein vergleichsweise kleines Überflutungsgebiet, weil man im Fluss selbst Platz schaffen kann für zusätzliches Wasser. Denn vor den Stauwehren der Wasserkraftwerke sammelt sich im Lauf der Zeit an der Sohle des Flussbetts Sand und Geröll aus den Alpen an. Bei Hochwasser werden die Stauwehre geöffnet.
(12. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Dann hat man plötzlich viel höhere Geschwindigkeiten in Stauräumen, und sehr, sehr viel Sohlmaterial kommt in Bewegung, wird weiter transportiert, und die Sohle sinkt stark ab. Und damit entsteht eben dann Volumen im Hochwasserfall, da bleibt mehr Wasser im Inn, als wenn ich jetzt von dieser Sohle im normalen Betriebszustand ausgehen würde.
ATMOS Wiese + Fluss
ERZÄHLERIN
An kleineren Flüssen braucht man keine aufwändigen Polder, um das Hochwasser erstmal in die Breite gehen zu lassen und damit die Welle flussabwärts zu kappen. Einfacher ist es, den Fluss bei Hochwasser dort aufzustauen, wo sich das Wasser in Auwiesen verteilen kann. Ein solches Hochwasser-Rückhaltebecken gibt es etwa an der Paar südlich von Augsburg. Dazu wird ein unauffälliges Stauwehr in den Fluss gebaut.
(13. Zusp.) Arnd Hartlieb
Bis zu einem gewissen Hochwasserabfluss fließt einfach das Gewässer weiterhin fröhlich durch die Landschaft, und erst, wenn eben ein bestimmter Abfluss erreicht wird, den die Unterlieger nicht mehr verkraften können, beginnt dann automatisch eine Drosselung, und da entsteht dann eben ein sehr großflächiger See, der allerdings relativ geringe Wassertiefen hat.
Musik 6: Aortic... aus: The Knick - Original Series Soundtrack – 25 Sek
ERZÄHLERIN
Immer wieder wird auch die Renaturierung von Flussauen gefordert, um dem Hochwasser Raum zu verschaffen. Arnd Hartlieb hat die Wirkung solcher Maßnahmen an der Donau untersucht, mithilfe rund 200 Jahre alter Landkarten und einem Computermodell. So konnte er das gleiche Hochwasser einmal durch die historische Landschaft schicken und einmal durch die heutige.
(14. ZUSP.) ARND HARTLIEB
Da kann man dann halt wirklich nachweisen, dass gerade bei diesen großen Hochwasserabflüssen sich gar nicht viel verändert, was Wasserstände und auch Zeitpunkte der Hochwasser Spitze sozusagen angeht, dass aber bei kleineren Hochwasserabflüssen diese Renaturierung schon einen deutlichen Effekt hat und eine Verbesserung bringt.
ERZÄHLERIN
Ist ein Fluss renaturiert, werden Polder also nur bei großen Hochwassern gebraucht – und an vielen Stellen ist auch ein Deich nötig, der Siedlungen und Infrastruktur schützt. In Stadtzentren stehen oft Mauern am Flussufer. Aber deren Höhe sind gestalterische Grenzen gesetzt. Und es gibt Extremsituationen, für die kein Deich, keine Mauer hoch genug sein kann. Etwa wenn im Winter Dauerregen und Schneeschmelze auf einen bereits wassergesättigten Boden treffen. Dann kommt die große Stunde des mobilen Hochwasserschutzes. Der Klassiker: Sandsäcke.
(15. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Sandsäcke sind für mich Steinzeit.
ERZÄHLERIN
Sagt Riku Reinhard Vogt vom Hochwasser-Kompetenz-Centrum, einem gemeinnützigen Verein; bis 2014 war er für den Hochwasser-Schutz der Stadt Köln verantwortlich.
(16. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Man brauche so viele Leute dafür. Das Ganze ist meistens undicht. Die sind nachher kontaminiert, sie sind nicht wiederverwendbar.
ERZÄHLERIN
Sandsäcke eignen sich, um schnell einen Deich zu flicken, aus dem das Hochwasser Stücke herausgerissen hat. Aber um etwa eine Siedlung zu schützen, auf die das Wasser zuströmt, gibt es bessere Systeme. Zum Beispiel riesige Schläuche. Die Feuerwehr befüllt sie am Einsatzort mit Wasser; sie hat Pumpen, mit denen das sehr schnell geht.
(17. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Und hat dann den Hochwasserschutz meistens bis zu einer Höhe von einem Meter, aber es gibt auch Systeme, wo mehrere Schläuche übereinander sind die also auch ohne weiteres drei Meter Höhe schaffen.
ERZÄHLERIN
Viel simpler und deshalb für Privathaushalte geeignet sind L-förmige Elemente, die man in einer Reihe nebeneinander aufstellen kann. Der kurze Schenkel am Boden zeigt in die Richtung, aus der das Hochwasser kommt und wird dann vom steigenden Wasser nach unten gedrückt, so steht die Wand stabil. Schnell aufgebaut ist auch ein Baukastensystem aus Europaletten oder anderen Platten, die mit Stützen aufrecht gestellt werden, plus einer kräftigen Folie.
(18. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Die Folie wird dann in den Rasen kurz mit einem Spaten hineingebracht, sodass da die Verbindung da ist, und diese Platten Systeme haben wir zum Beispiel 600 Meter in viereinhalb Stunden aufgebaut. Für 600 Meter braucht man 60.000 Sandsäcke, die hat man nicht in vier Stunden gefüllt, und die sind auch nicht so wirksam.
ERZÄHLERIN
Beliebt in hochwassergefährdeten Gemeinden sind so genannte Dammbalken-Wände, die man sich wie hochkant gestelltes Parkett vorstellen kann. Wobei die einzelnen Balken aus Aluminium bestehen, mit einer Gummidichtung. Damit lassen sich schnell enge Durchlässe schließen oder Mauern erhöhen – vorausgesetzt, man hat vorher entsprechende Halterungen für die Stützen und Wandanschlüsse installiert. Das erfordert also Planung und verursacht Kosten in trockenen Zeiten.
(19. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Mobiler Hochwasserschutz ist eine Investition, auch wenn sie sich auf Dauer rechnet. Aber keiner weiß natürlich, wann das nächste Hochwasser ist.
Musik 7: Conspiracy – siehe oben – 29 Sek
ERZÄHLERIN
Riku Reinhard Vogt berät Städte und Gemeinden in ganz Deutschland im Auftrag der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Er schaut sich an, wie gut sie auf Hochwasser vorbereitet sind und was sie verbessern können. Wie sieht der Bebauungsplan aus, welche Infrastruktur ist gefährdet? Hat die Gemeinde Alarmpläne und Gefahrenkarten? Wie sieht die Öffentlichkeitsarbeit aus?
(20. ZUSP.) RIKU REINHARD VOGT
Ich schlage immer wieder vor: Warum macht ihr nicht einfach an Laternenpfählen eine Marke für ein Extremhochwasser, so hoch kann es stehen, dann kann kein Mensch jemals sagen, er hat es nicht gewusst. Und jeder sich darauf vorbereiten.
Musik 8: Black Ostsee – siehe oben – 22 Sek
ERZÄHLERIN
In Bayern fördert das Landesamt für Umwelt diese so genannten Hochwasser-Audits. Und das Hochwasser-Kompetenz-Centrum, bietet etwas ähnliches für Privatleute und Firmen an, den Hochwasser-Pass, der auch als Gutachten für eine Elementarschaden-Versicherung anerkannt wird.
ATMO GEWITTER + STARKREGEN
ERZÄHLERIN
Wer sich aber jetzt zurücklehnt und meint, ich wohne weit weg von einem Fluss oder Bach – mich kann es nicht treffen – liegt falsch:
(21. ZUSP.) WOLFGANG GÜNTHERT
Starkregen ist etwas, was kurzzeitig innerhalb von Stunden passiert, ist eine Überflutung direkt vor Ort, und dann kann es jeden Ort treffen.
ATMO Kanalisation
ERZÄHLERIN
Warnt Professor Wolfgang Günthert vom Forschungszentrum RISK der Universität der Bundeswehr München. Weil immer mehr Flächen versiegelt sind, fließt das Wasser auf Straßen oder Feldwegen in die Orte. (ATMO Unterwasser) Und dort erstmal in den Kanal unter der Straße.
(22. ZUSP.) WOLFGANG GÜNTHERT
Man sagt, der Kanal nimmt üblicherweise ein seltenes Ereignis auf, was so alle drei bis fünf Jahre eintritt. Uns bei einem zehnjährigen, 15-jährigen Ereignis fließt es oben aus dem Kanaldeckel raus.
ERZÄHLERIN
Und von dort womöglich in den nächsten Keller. Starkregen werden durch den Klimawandel häufiger, deshalb versuchen einige Städte inzwischen, das Wasser an der Oberfläche in bestimmte Bahnen zu lenken; etwa auf einer Straße in einen Park, wo es versickern kann. Für solche Konzepte gibt es das griffige Schlagwort „Schwammstadt“.
(23. ZUSP.) WOLFGANG GÜNTHERT
Im Baugesetzbuch gibt es schon Vorgaben für die Bauleitplanung, dass Niederschlagswasser möglichst vor Ort wieder versickert werden soll, das steht da ganz klar drin. Auch im Wassergesetz steht es drin. Niederschlags¬wasser soll möglichst versickert werden.
ERZÄHLERIN
Um Schäden zu vermeiden und um das Grundwasser wieder aufzufüllen, das durch einige sehr trockene Jahre stark abgesunken ist. Aber Wolfgang Günthert sagt auch: Die Gemeinden sind nicht allein dafür zuständig, die Habe ihrer Bürgerinnen und Bürger vor Wasser zu schützen.
(24. ZUSP.) WOLFGANG GÜNTERT
Das erste ist, dass man in den Keller geht und schaut: Habe ich unwieder¬bringliche Dinge im Keller und die sofort aus dem Keller entfernen, nach oben bringen. Das zweite ist, im Keller zu schauen: Habe ich eine Rückstau¬sicherung vom Kanal. Wenn ich Starkregen habe, ist der Kanal ja bis zur Straßenoberkante voll, und wenn die Rückstausicherung bei mir im Haus nicht funktioniert, dann flute ich meine eigenen Keller. Und das ist etwas, da bin ich selbst verantwortlich, das wissen viele nicht. Und das dritte ist, was ich auch jedem rate: eine Elementarschadenversicherung zu haben.
MUSIK 9: BLACK OSTSEE – S.O. – 35 SEK
ERZÄHLERIN
Alle sollten sich also Gedanken darüber machen, wie sie sich vor Wasser schützen können. Aber vieles bleibt doch die Aufgabe von Kommunen oder dem Land – vor allem die Genehmigung großer Bauprojekte an Flüssen. Nur Polder, Deiche oder Mauern können Siedlungen, Industrieanlagen und Infrastruktur vor starkem Hochwasser in Flüssen bewahren. Viele dieser Baumaßnahmen wurden in Bayern nach großen Hochwassern geplant, etwa 1999 oder 2013 – und kamen dann ins Stocken. In den letzten Jahren zum Teil aufgrund steigender Baukosten.
(25. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Und die Bürgerbeteiligung kann sich ein Jahrzehnt oder länger hinziehen,
ERZÄHLERIN
weiß Albert Göttle, der Jahrzehnte lang für Hochwasser-Themen verantwortlich war. In den Debatten geht es etwa um die Befürchtung, dass, wenn ein Polder geöffnet wird, auch die Keller in benachbarten Wohngebieten voll laufen. Und die Grundbesitzer müssen überzeugt und ihre Entschädigung im Überflutungs-Fall geregelt werden. Dafür sind die Wasserwirtschaftsämter zuständig – die aber im Zuge der Entbürokratisierung in Bayern verkleinert oder zusammengelegt wurden. Viele Arbeiten mussten Ingenieurbüros übernehmen. Keine optimale Lösung, findet der Fachmann:
(26. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Die Ingenieurarbeit, die kann man auslagern. Aber zu wissen, was geplant werden muss, die Moderation zum Beispiel mit den Kommunen, wir haben dies und jenes Konzept: So etwas kann ein Ingenieurbüro bedingt machen. Eine Fachbehörde hat einen ganz anderen Zugang zu den Kommunen, weil sie in vieler Hinsicht – Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und so weiter – Partner der Kommune ist. Und diese Planungsleistung, Vorplanungsleistung, die wurde erschwert, indem man gutes Personal nicht erneuern konnte, wenn sie ausgeschieden sind, oder nicht so erneuern konnte, wie man es gebraucht hätte.
ERZÄHLERIN
Behörden sind auch gefragt, wenn es darum geht, gesetzliche Regelungen umzusetzen.
(27. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
Durch eine EU-Vorschrift ist es auch Pflicht, dass alle Länder in der EU sogenannte Hochwasserrisiko-Managementpläne machen.
ERZÄHLERIN
In Bayern findet man die Pläne auf den Webseiten des Landesamtes für Umwelt – einschließlich der wichtigen Gefahrenkarten. Die deutlich zeigen, welche Orte zu stark gefährdet sind, um dort ein neues Bau- oder Gewerbegebiet zu errichten. Was heute auch durch das Wasser-Haushaltsgesetz verboten ist. Früher war das anders.
(28. ZUSP.) ALBERT GÖTTLE
In Überschwemmungsgebieten wurden Siedlungen errichtet in den 60er 70er-Jahren, es gab Landratsämter, die waren so geführt von ihrem Landrat, dass man manches durchgewunken hat gegen den fachlichen Rat der Wasserwirtschaft, später kam dann die Wahrheit, und dann war Wehklagen und dann Ruf nach Entschädigung. Die Objekte, die im Hochwassergebiet wissentlich hineingebaut werden, sind weniger geworden, weil die Rechtsnormen, die man heute erfüllen muss und die lokale Entscheidungs-Kompetenz ein Stück verändert ist.
ERZÄHLERIN
Auch der Einspruch eines Wasserwirtschaftsamts hat heute mehr Gewicht. Damit nicht noch mehr Flächen versiegelt, einem Fluss nicht noch mehr Platz genommen wird für Hochwasser. Zum Schaden der Menschen flussabwärts.
MUSIK 10: BLACK OSTSEE – SIEHE OBEN – 41 SEK
ERZÄHLERIN
Hochwasserschutz – das sind große Bauwerke wie Deiche und Polder; kleinere wie ein Stauwehr oder eine Mauer; oder mobile Barrieren. Hochwasserschutz ist aber auch: Nicht zu bauen – im Überschwemmungsgebiet eines Flusses. Flächensparsam zu bauen, um nicht noch mehr Boden zu versiegeln. Hochwasserschutz ist: Forschen und Experimentieren, planen und debattieren, um die optimale Lösung für den jeweiligen Ort zu finden. Und es ist auch: Solidarität mit den Menschen, die im Nachbarort leben, oder weit flussabwärts.
MUSIK 11: TRUTH DEVELOPMENT INC – 46 SEK
Von den sieben Poldern die nach dem Pfingsthochwasser 1999 geplant wurden, sollten sechs an der Donau entstehen – bis heute gibt es dort nur einen. Die Menschen in Regensburg oder Passau können nur hoffen, dass die anderen fertig werden, bevor das nächste Hochwasser kommt. Kempten hingegen hatte die Solidarität der Menschen flussaufwärts im Illertal: Dort wurde innerhalb weniger Jahre ein Polder gebaut – als die Eindrücke vom Pfingsthochwasser 1999 noch frisch waren. Solidarität und schnelles Handeln – das sind also wichtige Erfolgsfaktoren für den Hochwasserschutz.
2478 قسمت
Tất cả các tập
×به Player FM خوش آمدید!
Player FM در سراسر وب را برای یافتن پادکست های با کیفیت اسکن می کند تا همین الان لذت ببرید. این بهترین برنامه ی پادکست است که در اندروید، آیفون و وب کار می کند. ثبت نام کنید تا اشتراک های شما در بین دستگاه های مختلف همگام سازی شود.